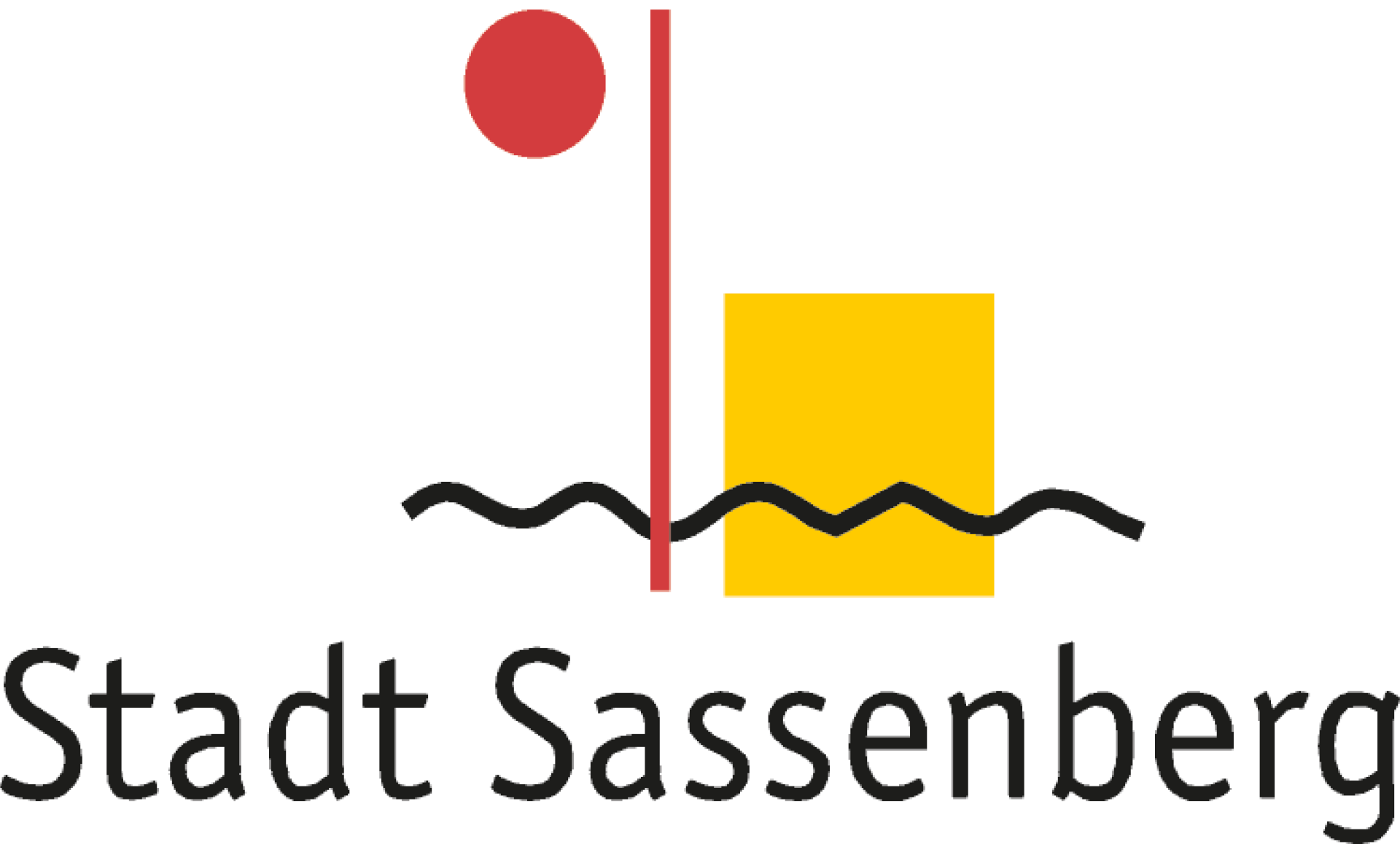Gröblinger Kapelle
Besonderes Merkmal in Gröblingen ist eine alte kleine Kapelle, die im Jahr 1688 errichtet wurde. Interessant ist dabei der Grund des Baus: Der Leinenhändler Heinrich Kleine hatte seinerzeit seinen Geldbeutel mit samt den Gold– und Silberstücken, die er den Leinentuchmachern auszahlen musste, verloren. In seiner Not machte er das Gelübde, an der Stelle, an der er das Geld finden würde, eine Kapelle zu errichten. Und tatsächlich fand er das Geld an der Stelle (Brinkstraße), an der die Eheleute Kleine/Zurstraßen ihr Gelübde erfüllten und die Marienkapelle errichteten.
Das Wappen der Zustrassens befindet sich im Rosettenfenster über dem Eingang des Kirchenanbaus von 1904. Dieses ist heraldisch erweitert durch das Wappen des belgischen Barons Louis Zustrassen. Er stiftete das Fenster nach seiner großzügigen Renovierung der Kirche im Jahre 1954/55.